- Startseite
- Überblick
- Digitales Kulturgut
- Forschung, Publikation & Projektorganisation
- IT-Infrastruktur
- Über uns
Die Grundlagen der Assoziator-Logik wurden von Dr. Susanne Bosche während ihres Dissertationsprojekt als Reaktion auf Tenor und Verlauf einiger Argumentationsgänge der theoretischen und theoretisierenden Archäologie entwickelt. Spätenstens seit der Mitte des 20. Jahrhunderts finden sich immer wieder Verweise auf einige zentrale (je nach Standpunkt) epistemologische bzw. ontologische Schwierigkeiten bei der Ausübung wissenschaftlicher Tätigkeit. Auffallenderweise werden diese Probleme zwar immer wieder betont, in den Argumentationsgängen teils der gleichen Arbeiten jedoch nicht oder nur eingeschränkt berücksichtigt. Mitgeprägt durch ihre Interessen an Philosophie, Wissenschaftstheorie, Mathematik, Physik und Informationswissenschaften hat sich für Dr. Susanne Bosche das Verhältnis zwischen dem Beobachter (verstanden als abstrakte Instanz mit der Fähigkeit, auf andere Instanzen Bezug zu nehmen) und seinem Beobachtungsgegenstand (verstanden als Instanz, an der Bezugnahmen ansetzen können) als Schlüssel für eine Annäherung an das Spannungsfeld herauskristallisiert. Entscheidend für den Aufbau ihrer Herangehensweise ist die Unmöglichkeit eines Beobachters, seine eigene Beobachtungsfähigkeit zu beweisen, da ein solcher Versuch letztlich immer die eigene Beobachtungsfähigkeit axiomatisch postuliert oder implizit voraussetzt. Jedoch führt der Versuch eines Selbstbeweises der eigenen Beobachtung zur immer weiter fortschreitenden 'internen' Ausdifferenzierung des Beobachters und zugleich zur 'externen' Ausdifferenzierung seiner Umwelt. Das später als Assoziator bezeichnete Konzept war geboren.
Assoziatoren sind Hilfskonzepte eines Beobachters zur Beschreibung seiner Selbst und/oder seiner Umwelt ohne eigenen ontologischen Status. Sie verfügen über mehrere Definitionselemente: eine Abgrenzung 'nach außen' (beobachtbar aus der Außenperspektive) und eine Abgrenzung 'nach innen' (den Standpunkt der Innenperspektive, der jeglicher Bezugnahme entzogen bleibt). Je nach Perspektive und Fokus 'erscheint' jedes Definitionselement als vorhanden, nicht vorhanden oder 'durchlässig'; Assoziatoren haben damit mehrere Zustände, deren Auftreten von der Perspektive des Beobachters abhängt. Sie können aus der Innenperspektive (Selbstbeschreibung) und der Außenperspektive (Fremdbeschreibung) betrachtet werden; bei jedem Versuch einer vollständigen Beschreibung wechselt der mobile Beobachter zwischen diesen beiden Perspektiven und muss daher eine 'Zeitdiskrepanz' zwischen seinen Einzelbeobachtungen in Kauf nehmen, deren Ausmaß und Bedeutung für den Assoziator der Beobachter nur durch weitere Beobachtungen erfassen könnte - die jede selbst eine erneute 'Zeitdifferenz' mit sich bringen. Durch den immer weiteren fortschreitenden Wechsel zwischen den Betrachtungsperspektiven differenziert der Beobachter seine Kenntnis über sich bzw. seine Umwelt (denn auch diese Abgrenzung hängt von der jeweiligen Perspektive ab) immer weiter aus: jeder Assoziator ist aus einer potentiell unendlichen Anzahl weiterer Assoziatoren aufgebaut, die dem Beobachter durch die Folge seiner Beobachtungen als 'ineinander gestaffelt' erscheinen.
Die Assoziator-Logik führt diese Konzeption im Detail weiter und entwickelt Verknüpfungsstrukturen, Argumentationsgänge und Anwendungsformen für die Anwendung dieser Grundkonzeption auf die Analyse menschlichen und kulturellen Verhaltens, die bei Rückgriffen auf die klassischen und nicht-klassischen Logiken immer wieder auf argumentative Probleme stoßen.
S. Bosche, Romanisierung ohne Rom? Überlegungen zum Charakter eines Phänomens. Beitrag zum Kongress „Romanisation – Romanization ?!?“, Heidelberg, 15-17. Dezember 2017 (im Erscheinungsvorgang)
S. Bosche, Distanzen. über die Beobachtung von Übermittlungen im republikanischen Italien (Diss. Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 2023), DiAuViS Schriftenreihe I (Heidelberg 2023), ‹http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/33937› pdf
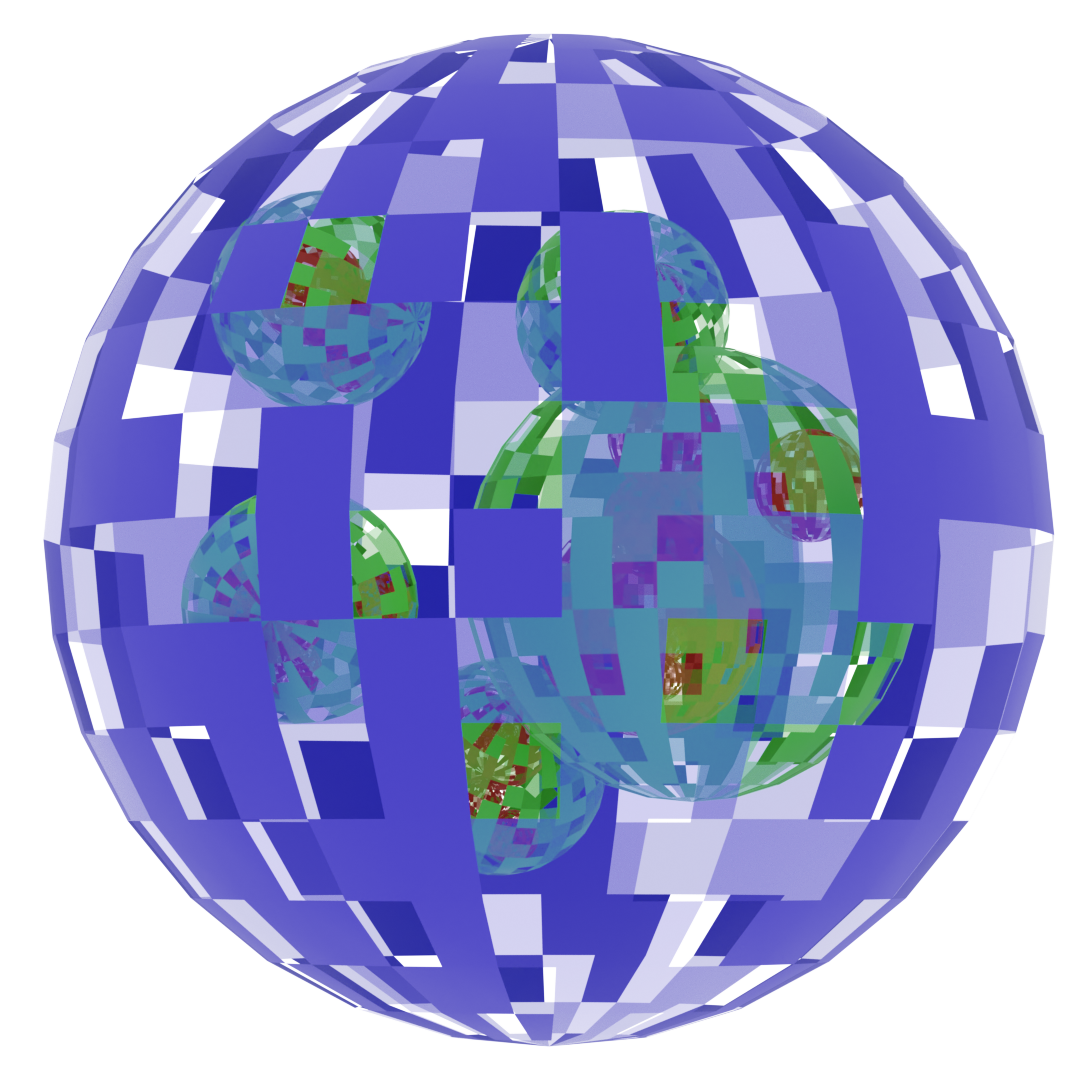

Musik, Akustik und Klang der Antike stehen nicht erst seit dem verstärkten Aufkommen der sog. Archäologie der Sinne im Fokus des Interesses. Ihre Untersuchung, Würdigung und Rezeption hat eine jahrhundertelange Tradition. Die heutige europäische Musik ist ohne die Konzepte der antiken Musiktheorie und -praxis nicht vorstellbar. Ihre Schriften wurden lange rezipiert und haben die Grundlage für unsere heutige Musikkultur gelegt. Bildliche Darstellungen und die wenigen erhaltenen Instrumente und Notationsreste faszinieren ihre Rezipienten seit eh und je. Spätestens im 19. Jahrhundert erfolgen die ersten Nachbauten antiker Instrumente; Gabriel Fauré komponiert im Jahr 1894 seine "Hymne à Apollon" in Anlehnung an die erhaltenen Reste eines der antiken delphischen Hymnen, eine der frühesten bekannten Melodien aus dem späten 2. Jahrhundert v.u.Z.
Uns sind aus der Antike eine Vielzahl bildlicher Darstellungen von Instrumenten und MusikerInnen, Reste von Notationen von Melodien, Überreste von Instrumenten und musiktheoretische Überlegungen erhalten. Trotzdem gestaltet sich die wissenschaftliche (nicht künstlerische) Rekonstruktion antiker Musik und Klänge sehr schwierig. Keines der Instrumente ist so vollständig erhalten, dass es als Klangkörper selbst erklingen könnte. Schriften und Notationen sind ebenfalls selektiv und fragmentarisch erhalten. Die antike Bildsprache darf nicht mit dem Realitätsbezug heutiger Photographien in Verbindung gebracht werden; sie liefert keine Baupläne antiker Instrumente, sondern bindet sich in übergeordnete Bildkompositionen ein. Die Rekonstruktion antiker Musik, Akustik und antiker Klänge sieht sich daher mit massiven Herausforderungen konfrontiert.
Ausgangspunkt unsere Herangehensweise sind umfassende wissenschaftstheoretische und methodenkritische Arbeiten und Überlegungen. Auf ihrer Basis erarbeiten wir Verfahren zur Annäherung an antike Klänge, Musik und Akustik, die die heutigen wissenschaftlichen Standards erfüllen und zugleich Höreindrücke zu kommunizieren vermögen. Ein wichtiger, zentraler Schlüssel für dieses Vorhaben ist die Konstanz physikalischer Eigenschaften von Materialien (nicht Artefakten!) durch die Jahrhunderte. Sie bietet uns ein Bindeglied zwischen heute und damals und zugleich die Basis für weitergehende Analysen. Eine große Hilfe sind digitale Verfahren, die mit vergleichsweise geringem Aufwand umfassende und variantenreiche Simulationen physikalischen Verhaltens ermöglichen. Umsichtig angewandt und parallel und nachfolgend mit weiteren 'analogen' Verfahren kombiniert, lassen sich wichtige Anknüpfungspunkte zwischen der heutigen und der antiken Klang- und Tonwelt herstellen.
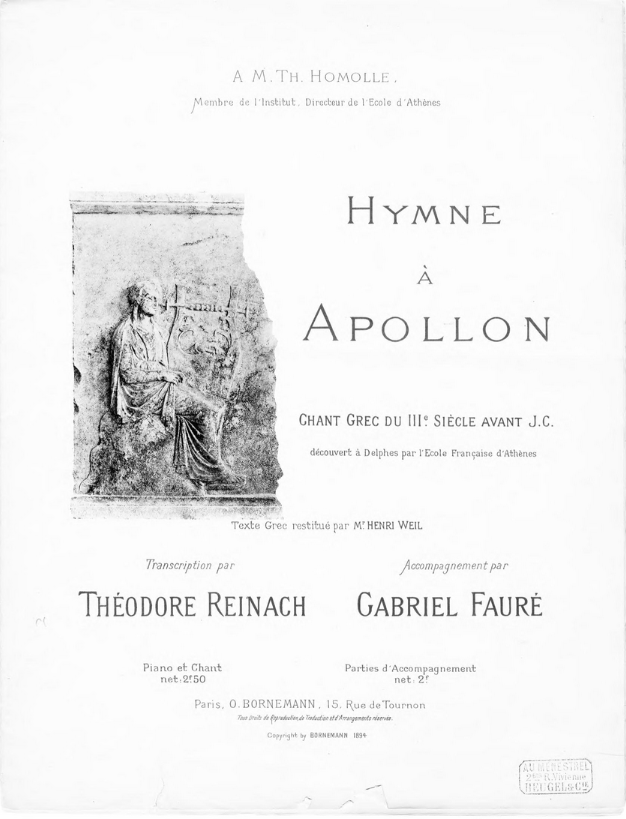


Die Digitalisierung historischer Artefakte hat sich zu einem bedeutenden Zweig historischer Wissenschaften entwickelt. Nicht nur innerhalb der Spezialdisziplin "Digital Humanities" werden vermehrt Digitalangebote eingesetzt, um historische Artefakte den Wissenschaften und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Trotz ihres weit fortgeschrittenen Entwicklungsstands und großen Potentials sehen sich Digitalisierungsverfahren wie die Photographie, Photogrammetrie und die 3D-Scanning noch immer mit methoden- und erkenntnistheoretischen Einschränkungen konfrontiert. Insbesondere der für viele Forschungsprojekte notwendige sehr hohe Präzisionsgrad stellt das benötigte technische Equipment vor teils enorme Herausforderungen. Gemeinsam mit dem Greifenberger Institut für Musikinstrumentenkunde entwickeln wir Optimierungsstrategien für die verschiedenen Verfahren und Möglichkeiten zur zielgerichteten und bedürfnisorientierten Kombination mehrerer Einzelverfahren. Ein reflektiertes Zusammenziehen von Informationen der Koordinatenmesstechnik, Photographie und Photogrammetrie und des 3D-Scannings kann und soll uns eine Basis für eine wissenschaftstheoretisch begründbare Anwendung von Digitalisierungsverfahren in wissenschaftlichen Untersuchungen bieten.
Aktuell liegt unser Fokus auf der Detailpräzision, Messgenauigkeit und Farbechtheit der Modelle.
Historische Instrumente sind ein wichtiges Kulturgut. Sie ermöglichen uns eine Annäherung an die Töne und Klänge, an Handwerk und Technik, und nicht zuletzt Kunst, Kultur und Gesellschaft von Menschen vergangener Zeiten. Doch vielfach sind die Originale durch verschiedene Faktoren bedroht. Ihr Erhaltungszustand ist fragil, wichtige Bauteile fehlen, sie sind aus vergänglichem Material gefertigt, oder sollen in unserer Zeit wieder zum Leben erweckt werden - beispielsweise im Zuge der historischen Aufführungspraxis von Kompositionen aus früheren Zeiten. Auch die Zugänglichkeit zu den Originalen ist oft eingeschränkt und nur Museumsbesuchern an einem bestimmten Ort oder gar nur wenigen Eingeweihten uneingeschränkt möglich. Umso wichtiger ist es, die Originale in ihrem historischen Zustand zu dokumentieren und einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Digitale Dokumentations-, Mess- und Präsentationsformen stellen hierfür ein ideales Medium dar. Unter Nutzung unserer Digitalverfahren untersuchen und digitalisieren wir historische Instrumente, um sie der Wissenschaft und einem breiten Publikum zugänglich zu machen.
Wir verfolgen dieses Projekt in Kooperation mit dem Greifenberger Institut für Musikinstrumentenkunde.


Um ein Tasteninstrument zum wohlgestimmten Klingen zu bringen, müssen die Saiten, die im Korpus verlaufen, durch Zug gespannt werden, bis sie auf der gewünschten Tonhöhe erklingen. Durch die anliegende Spannung werden der Korpus in seiner Gesamtheit und insbesondere einzelne Bauteile wie der Resonanzboden teils erheblich verformt. Von diesen Verformungen betroffen sind nicht nur moderne Instrumente, sondern auch historische Saiteninstrumente, die ihre Form im Laufe ihres Lebens mehrmals durch Anlegen und Entfernen der Saitenspannung verändern. Gemeinsam mit dem Greifenberger Institut für Musikinstrumentenkunde untersuchen und analysieren wir diese Verformungen. Die messbaren Veränderungen an modernen Nachbauten erlauben uns ein vertieftes Verständnis der den Deformationen zugrunde liegenden physikalischen Vorgängen, das wir auf unsere Untersuchungen der historischen Originale übertragen können.
Für unsere Untersuchungen nutzen wir unsere digitalen Mess- und Dokumentationsverfahren.
Im Fokus des größtenteils als Dissertationsprojekt betriebenen Projekts steht eine kritische Betrachtung und Würdigung der epistemologischen und methodologischen Grenzen und Möglichkeiten für die Untersuchung von Kulturkontaktphänomenen der Vergangenheit, untersucht am Beispiel der sog. Romanisierung / Romanisation. Erste Vorläufer des späteren Hauptprojekts manifestieren sich in der M.A.-Arbeit von Dr. Susanne Bosche, die sich mit Berufsdarstellungen in der römischen Provinz Gallia Belgica auseinandersetzt. Es folgt ein Wechsel in das Gebiet des römischen Italiens in republikanischer Zeit und zu öffentlichen Bauten, Heiligtümern und überregionalen Regelungen, die im Fokus des Dissertationsprojekts von Dr. Susanne Bosche stehen und in der Hauptpublikation "Distanzen" erörtert werden. Das Projekt "Assoziator-Logik" ist während der Arbeit an diesem Projekt entstanden, und seine Konzepte durchdringen große Teile der archäologischen Publikationen.
Die Verflechtung von sozialen und kulturellen Faktoren spielt in der Romanisierungsforschung eine zentrale Rolle. Viele Stimmen befürworten die Annahme wechselseitiger Interdependenzen zwischen diesen beiden Bereichen, ohne jedoch ihre Trennung vollständig aus der Betrachtung der Phänomene zu eliminieren. Die Arbeit „Distanzen. über die Beobachtung von Übermittlungen im republikanischen Italien“ von Susanne Bosche setzt ebenfalls an dieser Sichtweise an, unterzieht sie aber einer kritischen Betrachtung. Sie widmet sich der Frage, ob zwischen Regelungen der machtpolitischen Relationen, die im Zeitraum des 4. bis frühen 1. Jahrhundert v.u.Z. zwischen Städten im Gebiet der heutigen italienischen Halbinsel geschlossen wurden, und der Errichtung öffentlicher Bauten mit potentiellem politischen Bezug im selben Gebiet und Zeitraum ein Zusammenhang besteht oder bestehen könnte. Die Ausgangsbasis der Überlegungen bildet die Materialbasis selbst. Nach einer Vorselektion konnten Informationen aus den antiken Schriftquellen und archäologische Überreste von über 70 Zeugnissen über zwischenstädtische Regelungen respektive 240 Tempeln, basilicae, comitia-curiae und fora in die Untersuchung einbezogen werden. Bei der Diskussion möglicher Interdependenzen gelangt die Arbeit jedoch an einen entscheidenden Wendepunkt. Die für sie benötigten Argumentationsgänge bewegen sich in wissenschaftstheoretischen und epistemologischen Hochrisikobereichen – wie lässt sich die Thematik trotz und mit dieser Problematik weiter verfolgen? Die Arbeit verlässt den materialbezogenen Bereich und widmet sich den theoretischen Grenzen und Risiken, aber auch Möglichkeiten und Chancen. Die Untersuchung antiker Kontaktphänomene anhand ihrer materiellen Hinterlassenschaften stellt die moderne Wissenschaft vor enorme Herausforderungen. Architektonisch fassbare Tempel, basilicae, comitia-curiae und fora sind zumeist nur sehr fragmentarisch erhalten. Die Begriffe der antiken Schriftquellen lassen sich gerade im Detail oft nicht sicher interpretieren; im Formulierungskontext fehlen für den Argumentationsgang zentrale Zusatzinformationen. Dies erschwert nicht nur die sozialhistorische bzw. baugeschichtliche Erfassung und Datierung der Maßnahmen, sondern auch die Möglichkeit, durch Vergleiche Rückschlüsse auf eventuelle gegenseitige Beeinflussungen zu ziehen. Das Buch „Distanzen“ spricht sich dafür aus, dieser Grundproblematik mit einer alternativen Herangehens- und Argumentationsweise zu begegnen. Es vertritt die Ansicht, dass der Schlüssel zur Lösung dieses Problems nur vordergründig in der Beschaffenheit der Daten und Informationen begründet liegt. Deutlich stärker ins Gewicht fällt, auf welche Art und Weise wir unsere Schriftquellen, Begriffe und materiellen überreste verstehen und konzipieren. Basierend auf dieser Sichtweise entwickelt sich ein argumentativer Lösungsvorschlag, der die material- und methodenbasierten Argumentationen mit aktuellen Debatten der speziellen archäologischen Wissenschaftstheorie verbindet. Aus dieser Perspektive betrachtet zeigt sich, dass sich mögliche Zusammenhänge und Interdependenzen teilweise in einem hintergründigen Bereich entfalten können, beispielsweise in der Herausbildung von Strukturen im sozialen/kulturellen Gefüge.
S. Bosche, Die Selbstrepräsentation von Handwerkern und Händlern im Grabkontext in der Provinz Gallia Belgica. Aspekte der Vermittlung sozialer Identität in einer multikulturellen Gesellschaft, Daidalos 6 (Heidelberg 2016) pdf
S. Bosche, Romanisierung ohne Rom? Überlegungen zum Charakter eines Phänomens. Beitrag zum Kongress „Romanisation – Romanization ?!?“, Heidelberg, 15-17. Dezember 2017 (im Erscheinungsvorgang)
S. Bosche, Im Spannungsfeld von lokaler Planung und überregionalem Kontakt. Zur Genese von Tempelgrundrissen im italischen Raum des späten 4.-frühen 1. Jh. v.u.Z. Beitrag zur Tagung „Italien in hellenistischer Zeit“, Trier, 19.-20. Juli 2019 (im Erscheinungsvorgang)
S. Bosche, Distanzen. über die Beobachtung von Übermittlungen im republikanischen Italien (Diss. Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 2023), DiAuViS Schriftenreihe I (Heidelberg 2023), ‹http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/33937› pdf
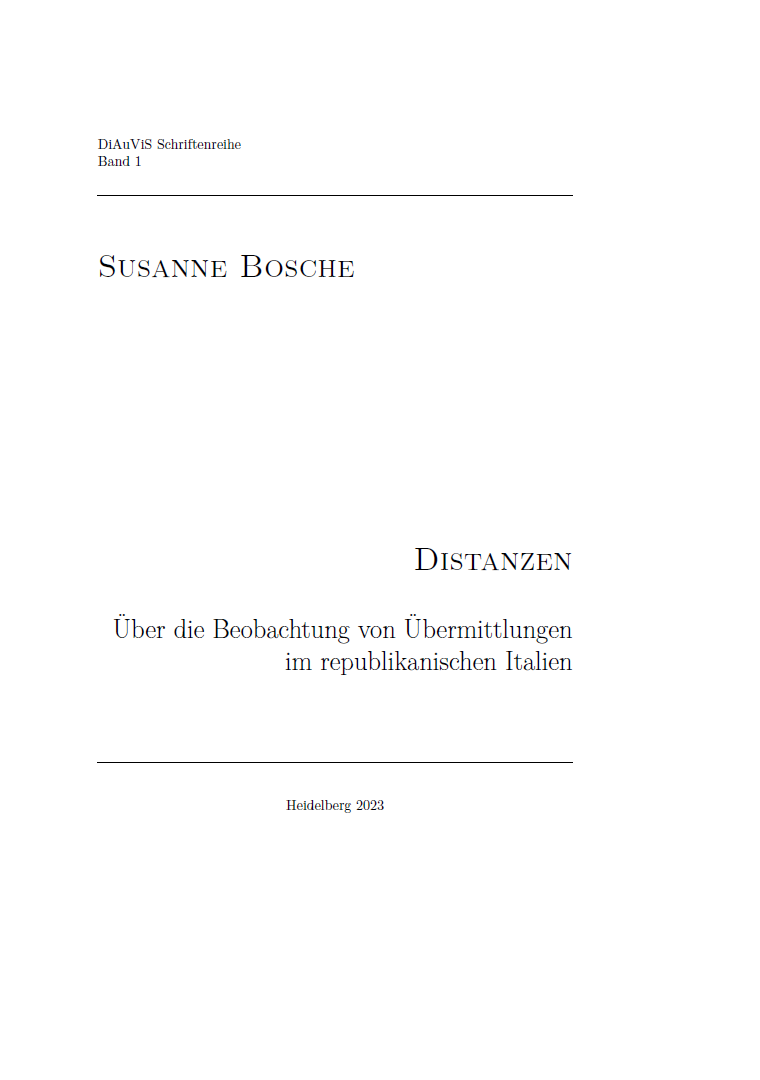

Das von der DFG-geförderte Forschungsprojekt widmet sich bronzenen Beleuchtungsgeräten aus den Vesuvstädten und geht dabei besonders der Frage nach, wie das Kunstlicht und die daraus entstehende Lichtkunst das gemeinschaftliche Leben der Römer beeinflussten. Die Ergebnisse wurden der Öffentlichkeit in zwei Forschungsausstellungen präsentiert, in den Staatlichen Antikensammlungen München (9.11.2022–9.4.2023) und in den Kapitolinischen Museen Rom (5.7.–8.10.2023).
R. Bielfeldt – J. Eber – S. Bosche – A. Lutz – F. Knauß (Hrsg.), Neues Licht aus Pompeji, Ausstellungskatalog München (Oppenheim am Rhein 2022)