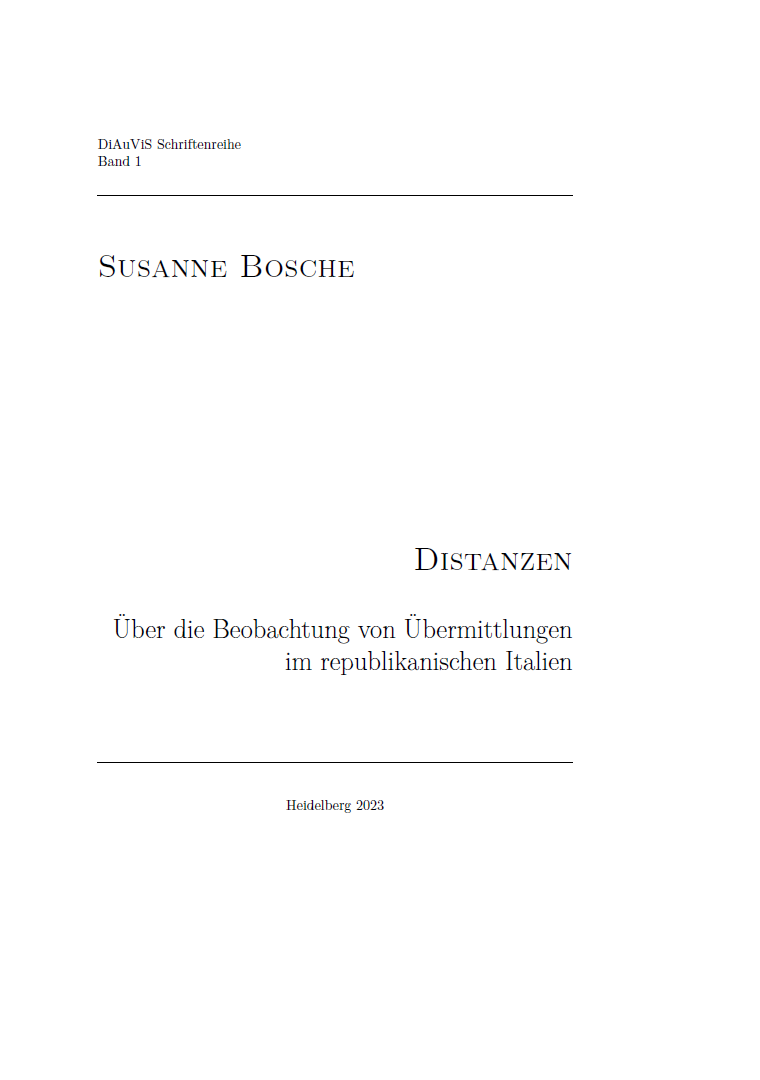Durch ihre Offenlegung tritt die Forschungsarbeit in einen internationalen Diskurs und erfährt öffentliche Anerkennung.
Am Abschluss jedes Forschungsvorhabens und jedes Teilschritts eines wissenschaftlichen Projekts steht die Publikation der entwickelten Verfahren und Resultate. Die Grundlagen für die Publikation bilden die zuvor angestellten Recherchen und Dokumentationen, die nun (erneut) systematisch ausgewertet und aufgearbeitet werden. Bei der Konzeption und Anlage einer Publikation gilt es, das Zielpublikum zu berücksichtigen. Ein Aufsatz in einem Fachjournal nutzt eine andere Struktur, Stilistik und Sprache als eine Präsentation im populärwissenschaftlichen Rahmen. Ausstellungsformate schlagen die Brücke zwischen diesen beiden Welten. Um den größtmöglichen Impact zu erreichen, empfiehlt es sich, die Resultate der eigenen Arbeit in mehreren unterschiedlichen Medien mit verschiedenem, jeweils möglichst breiten Zielpublikum zu präsentieren.
Ungeachtet der Ausrichtung ist beim Verfassen einer Publikation auf die Einhaltung der wissenschaftlichen Grundsätze zu achten. Die Aussagen, Daten, Informationen und Verfahren müssen transparent, nachvollziehbar und vollständig dargelegt werden. Schlussfolgerungen müssen explizit begründet und Prämissen und Ausgangshypothesen müssen offengelegt werden. Alternative Ansätze und widersprüchliche Modelle und Hypothesen müssen berücksichtigt und kritisch gewürdigt werden.
Den Kern und zugleich Rahmen jeder Publikation bilden die Protokolle der Datenaufnahme und Verweise auf genutzte Primär- und Sekundärliteratur. Eine vollständige, präzise und formal richtige Darlegung aller Quellen, Messungen und Daten ist die Stütze jedes Argumentationsgangs. Alle weiterführenden Argumentationsgänge und Hypothesen bauen auf diesem Kern auf. Bei ihrer Formulierung ist auf die Einnahme verschiedener Perspektiven zu achten, damit die Argumentationsstrukturen möglichst wasserdicht zum Ausdruck gebracht werden können.
Bevor eine Publikation ihrem Publikum zugänglich gemacht wird, folgen idealerweise mehrere Peer Reviews und kritische Diskussionen mit FachkollegInnen zur Überprüfung, Kontrolle und erneuten kritischen Betrachtung. Nach Wahl und Akzeptanz einer/s Verlags bzw. HerausgeberIn folgt die
formale Überarbeitung unter Einhaltung der spezifischen Vorgaben.